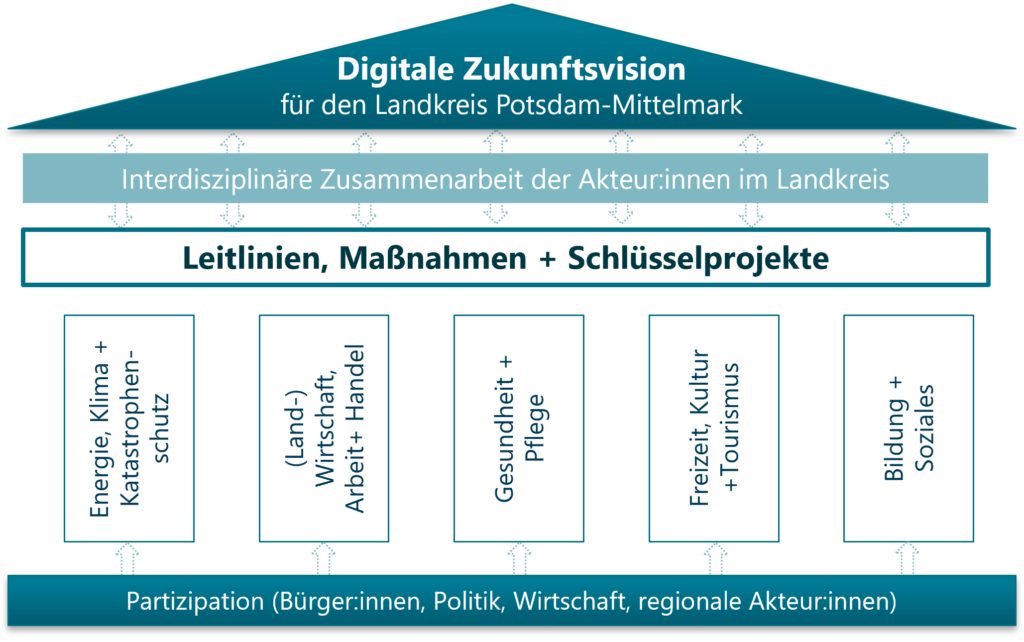Digitalisierung
Für die smarte Zukunft von Gemeinden, Städten und Regionen
Wir zeigen die Potenziale digitaler Standortentwicklung vor Ort auf und helfen, diese gemeinschaftlich und bedarfsgerecht zu erschließen – für zukunftsfähige und resiliente Lebensräume.
- Wir beantworten Digitalisierungsfragen auf der Ebene, auf der sie gestellt werden - und machen Digitalisierung (be-)greifbar.
- Wir sind unabhängiger Übersetzer an der Schnittstelle zwischen „klassischer“ und technik-getriebener Stadt- und Regionalentwicklung.
- Wir sind Digitaler Thinktank und fungieren als Coach, Support oder Lead in der Umsetzung.
- Analyse und Bewertung digitaler Infrastruktur und Prozesse
- Gestaltung digitaler (Lebens-) Räume
- Digitale Kompetenzvermittlung
- Einsatz und Etablierung digitaler Möglichkeiten
- Prozess- und Projektmanagement
- Gemeinden, Kommunen, Landkreise, Regionen
- Kammern, Verbände, Institutionen, Unternehmen
- cima-DNA: seit 35 Jahren umfassende Handels-, Stadt-, Regionalentwicklungsexpertise - von der Strategie bis zur Umsetzung
- Begleitung von Modell- und Forschungsvorhaben
- Bundesweiter Know-how-Transfer in unserem Partnernetzwerk
Unsere Produkte und Leistungen
Wir unterstützen Sie sowohl konzeptionell als auch bei der Umsetzung. Natürlich individuell an Ihren Bedarf angepasst.
Das Team der cima.digital ist bundesweit im Einsatz. Die Kolleg*innen im Team arbeiten digital, remote und flexibel ortsunabhängig zusammen. Durch die Zusammenarbeit unseres agilen Digital-Kompetenzteams und den „Lokalexpert*innen“ der cima-Büros vor Ort können wir sowohl die notwendige Expertise bieten als auch den lokalen und regionalen Bezug vor Ort sicherstellen und aus mehr als 35 Jahren Erfahrung profitieren. Somit stehen wir zugleich auch für unser Verständnis von „new work“ und einer ressourcenschonenden, ökologischen und ökonomischen Prozessgestaltung.

Für welches Vorhaben dürfen
wir Sie beraten?
Vertrauen Sie bei der Beratung auf unsere Kompetenz. Gerne steht Ihnen unser Team unter der EMail-Adresse cima.digital@cima.de für Ihre Fragen zur Verfügung.
Produktblätter als PDF zum Download
Wir unterstützen Gemeinden, Städte und Regionen sowohl konzeptionell als auch bei der Umsetzung. Darüber hinaus halten wir Keynotes sowie Impulsvorträge und bieten Workshops an zu verschiedenen Themen im Bereich Digitalisierung von Kommunen. Eine Auswahl von Produktblättern mit weiterführenden Informationen haben wir hier zusammengestellt.